ETH Zürich / Julian Léonard
(Ausschnitt)
Redaktion. Physiker erzeugen eine Quantensubstanz mit paradoxen Eigenschaften: ein Atomgitter, das besser fließen kann als eine Flüssigkeit.
Wer sich ein wenig mit der Quantenphysik auskennt, hat vor allem eins gelernt: Sag niemals nie! So wie Schrödingers Katze zugleich tot und lebendig sein kann, gibt es auch viele andere Quantenphänomene, die der menschlichen Alltagsanschauung widersprechen. In das Kabinett der quantenphysikalischen Kuriositäten gehören nun auch Substanzen, die zugleich fest und flüssig sind: Ihre Atome sind wie in einem Festkörper in regelmäßigen Abständen angeordnet, lassen sich aber wie in einer Flüssigkeit leicht verschieben.
Aus dem Schulunterricht sind drei Aggregatzustände bekannt: fest, flüssig und gasförmig. In einem Festkörper sind die Atome oder Moleküle fest angeordnet. In einer Flüssigkeit oder einem Gas können sie sich frei bewegen. Physikstudenten lernen schließlich noch zwei weitere Aggregatzustände kennen: Erhöht man die Temperatur eines Gases, kann ein Plasma entstehen, dessen Bestandteile ionisiert sind. Und kühlt man Materie extrem stark ab, bis ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt, kann sich ein so genanntes Bose-Einstein-Kondensat bilden.
Widerstandslos fließen
In solch einem Kondensat konnten nun gleich zwei Forschergruppen unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Methoden einen weiteren, bisher unbekannten Zustand realisieren: einen so genannten Suprafestkörper. Darunter verstehen Physiker einen Materiezustand, der zugleich Eigenschaften einer Supraflüssigkeit und eines Festkörpers zeigt.
Bose-Einstein-Kondensate sind eigenartige Materiezustände, bei denen sich alle Atome in einem einzigen Energiezustand befinden und sich wie ein einziges Atom verhalten. Sie können deshalb widerstandslos umeinanderfließen – man nennt dies Supraflüssigkeit. Albert Einstein hatte die Existenz eines solchen Kondensats bereits 1924 vorhergesagt und sich dabei auf Arbeiten des indischen Theoretikers Satyendra Bose berufen. Es dauerte aber bis 1995, als es Eric Cornell, Carl Wieman und Wolfgang Ketterle schließlich gelang, ein solches Kondensat erstmals im Labor zu erzeugen, wofür sie 2001 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt wurden.
Ketterles Arbeitsgruppe am Massachusetts Institute of Technology ist auch eine von zweien, die nun einen Suprafestkörper nachweisen konnten. Sein Team nutzte ein ultrakaltes, supraflüssiges Bose-Einstein-Kondensat aus Natriumatomen, die sie mit einem Laser in einer optischen Falle einschlossen. “Das Bose-Einstein-Kondensat wurde in zwei Spinzuständen präpariert”, sagt Ketterle.
Der Spin – gewissermaßen die Eigenrotation der Atome – konnte so entweder nach oben oder nach unten zeigen und ließ sich mit Hilfe von Laserstrahlen hin- und herschalten. Durch präzise eingestrahltes Laserlicht gelang es den Forschern dann, die Atome so “anzuschubsen”, dass sie sich in einem regelmäßigen “Tigerstreifenmuster” anordneten. Obwohl das Kondensat noch supraflüssig war, nahm es eine Ordnung an, wie man sie laut theoretischen Berechnungen bei einem Festkörper erwarten würde.

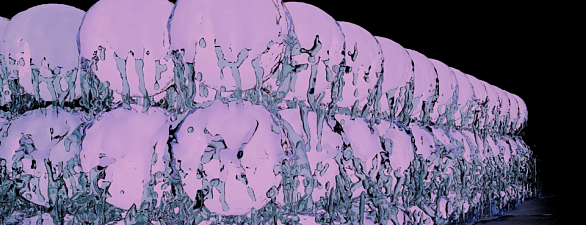
Neueste Kommentare